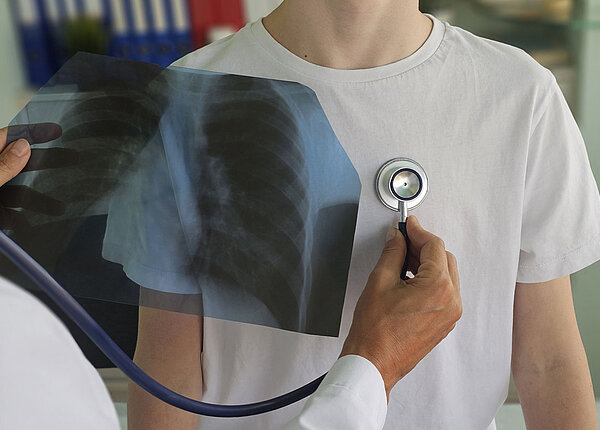Alles über Jod – ist Deutschland ein Jodmangelgebiet?
18 Minuten
- 1Jod im Körper
- 2Schilddrüsenhormone
- 3Jodbedarf
- 4Jodmangel
- 5Jodversorgung in Deutschland
- 6Ist Jod toxisch?!
- 7Atomare Unfälle
- 8Lernerfolgskontrolle
01. September 2025
Chronischer Jodmangel macht müde
Enthält die Nahrung regelmäßig zu wenig Jod, kann dies sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern zu einer Schilddrüsenunterfunktion mit einer verminderten Produktion der Schilddrüsenhormone führen (Hypothyreose). Das erste diagnostische Anzeichen sind leicht erhöhte TSH-Werte. Die Hypothyreose kann einhergehen mit Symptomen wie
- Müdigkeit,
- Schwäche,
- mentaler und körperlicher Leistungsminderung,
- vermindertem Grundumsatz mit Gewichtszunahme,
- verlangsamtem Herzschlag,
- trockener und blasser Haut,
- brüchigen Nägeln,
- Apathie,
- Konzentrationsstörungen,
- Appetitlosigkeit,
- Verstopfung sowie
- depressiven Verstimmungen.
Bei Kindern und Jugendlichen kann es neben der verminderten mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit zu einer verzögerten Entwicklung kommen. In Studien konnte gezeigt werden, dass die Behandlung von leichtem bis mittelschwerem Jodmangel bei Kindern zu einer Verbesserung der kognitiven Leistungen führte.
Kropf durch Jodmangel
Zunächst kann bei einem chronischen, aber moderaten Jodmangel durch vermehrte Resorption und erhöhte renale Wiedergewinnung eine ausreichende Synthese von Schilddrüsenhormonen über eine gewisse Zeit aufrechterhalten werden. Die anhaltende Stimulation der Schilddrüse führt allerdings zu einer Wucherung des Gewebes. Das Wachstum ist eine physiologische Anpassungsreaktion des Körpers, der versucht, den chronischen Jodmangel durch mehr hormonproduzierendes Gewebe zu kompensieren.
Dies funktioniert natürlich nicht, wenn nicht genügend Jod vorhanden ist. Die Wucherungen begünstigen die Entstehung von Strumen (Kröpfen) und Schilddrüsenautonomien. Bei einer gleichmäßigen Vergrößerung spricht man von einer Struma diffusa, während man das Wachstum mit Knotenbildung als Struma nodosa bezeichnet.
In den sogenannten kalten Knoten haben die Zellen ihre Funktion aufgegeben und produzieren keine Schilddrüsenhormone mehr. Die überwiegende Mehrzahl der kalten Knoten ist gutartig, in sehr wenigen Fällen können sie aber auch entarten.
In den sogenannten heißen Knoten oder autonomen Adenomen produzieren aktive oder überaktive Zellen unabhängig vom Bedarf zu viele Hormone. Sie sprechen nicht mehr auf die Regulierung durch Hypothalamus und Hypophyse an. Heiße Knoten sind in der Regel gutartig, können jedoch eine Überfunktion der Schilddrüse verursachen.
Eine Struma diffusa, also ein Kropf, ist keinesfalls nur ein kosmetisches Problem. Je nach Größe kann er Druck auf Speise- und Luftröhre und auch auf die Blutgefäße im Halsbereich ausüben. Schluckbeschwerden, Luftnot und Beklemmungsgefühle können die Folgen sein.

In den Alpenländern, die ja weit weg vom Meer liegen, ist das Jodvorkommen in den Böden besonders gering. Dementsprechend sind auch die dort angebauten Lebensmittel jodarm. Das führte viele Jahrhunderte dazu, dass besonders die Schweizer Bergbevölkerung großflächig unter Jodmangel und damit an einem Mangel an Schilddrüsenhormonen litt. Seefisch stand nicht auf deren Speiseplan. Der Kropf war daher etwas ganz Alltägliches.
Das Kropfband
In Teilen Bayerns, Österreichs und der Schweiz gehört das sogenannte Kropfband noch heute zur landestypischen Tracht. Es handelt sich dabei um ein breites Band, häufig aus Samt und mit Perlen, Schmucksteinen und Stickereien verziert, das zu festlichen Anlässen enganliegend am Hals getragen wird. Der ursprüngliche Zweck war, den Kropf selbst oder Narben nach einer Kropfoperation zu verdecken.
Und auch Kretinismus war weit verbreitet. In jedem Dorf lebten Menschen, die gehörlos oder kleinwüchsig waren, Fehlbildungen der Extremitäten oder Lernbehinderungen hatten. Auch die Zahl der Fehl- oder Totgeburten war deutlich erhöht. Zur Prävention von Jodmangel wird in der Schweiz seit 1920 Speisesalz auf freiwilliger Basis mit Jod angereichert. Dank dieser Maßnahme sind die früher stark verbreiteten Jodmangelerkrankungen verschwunden.