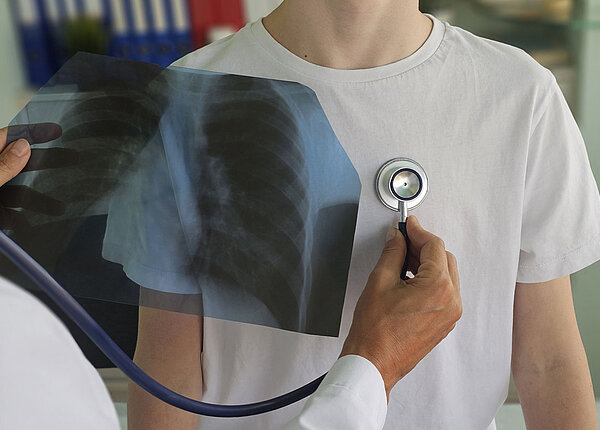Alles über Jod – ist Deutschland ein Jodmangelgebiet?
18 Minuten
- 1Jod im Körper
- 2Schilddrüsenhormone
- 3Jodbedarf
- 4Jodmangel
- 5Jodversorgung in Deutschland
- 6Ist Jod toxisch?!
- 7Atomare Unfälle
- 8Lernerfolgskontrolle
01. September 2025
Geringe Toxizität von Jod
Von Erwachsenen mit einer gesunden Schilddrüse wird eine Jodzufuhr in Form von Jodid oder Jodat oberhalb der genannten Empfehlung von 200 µg/Tag üblicherweise gut vertragen. Überschüssiges Jodid, das nicht in die Schilddrüse aufgenommen wird, scheidet der Körper rasch wieder über die Niere aus.
Erst ein Jodexzess von 10 bis 50 mg/Tag führt zur Hemmung der Schilddrüsenfunktion und zur Entwicklung einer Hypothyreose, da es zu einer vorübergehenden Blockade der Jodidaufnahme in die Schilddrüse und einer verminderten Hormonproduktion sowie langfristig zur Hemmung der Schilddrüsenhormonsekretion kommt.
Interessanterweise kann es also sowohl bei einem Jodmangel als auch bei einer exzessiven Jodzufuhr zu einer Schilddrüsenfunktionsstörung im Sinne einer Hypothyreose kommen.
Eine gewisse Gefahr, solche Jodmengen aufzunehmen, besteht bei häufigem Verzehr besonders jodreicher Algen.
Eine akute Vergiftung ist nur nach Aufnahme einer extrem großen Jodmenge im Gramm-Bereich möglich, beispielsweise durch die Einnahme von Jodtinktur. Diese Mengen kann man durch eine normale Ernährung nicht erreichen, selbst wenn alle Speisen mit jodiertem Speisesalz hergestellt werden. Je nach Schweregrad äußert sich die akute Intoxikation durch Bauchkrämpfe, Erbrechen, Harnverhalten, Fieber, Zyanose und Koma.
Stammt unser Jod wirklich aus atomaren Abfällen?
Welche wichtige Rolle Jod für den menschlichen Körper spielt und welche gesundheitlichen Folgen ein Jodmangel hat, das ist heute hinreichend bekannt. Dennoch treten immer wieder Fragen auf und es kursieren jodkritische Behauptungen. Vielleicht werden Sie auch von Ihren Kunden darauf angesprochen.
Zunächst einmal: nein! Das Jod im jodierten Salz stammt aus natürlichen Quellen und nicht aus atomaren Abfällen oder sonstigem Sondermüll, auch wenn dies in einigen Foren im Internet behauptet wird.
Jod für die Anreicherung von Speisesalz und für die Herstellung von Jodtabletten wird heute überwiegend aus Chilesalpeter (NaNO3) gewonnen, der beim Abbau ungefähr 0,1 Prozent Jodat enthält. Die jodhaltigen Lösungen werden zunächst gereinigt, dann wird Kalium- oder Natriumjodat daraus hergestellt. In Deutschland wird für das jodierte Speisesalz vor allem Kaliumjodat verwendet und als Lösung auf die Kochsalzkristalle aufgesprüht.

Früher wurde Jod in Form von Jodid und Jodat industriell durch die Verbrennung von Seetang gewonnen, der am Strand gesammelt wurde. Die Asche enthält etwa 0,1 bis 0,5 Prozent Jod. Weltweit werden heute aber nur noch rund 2 Prozent des Bedarfs auf diese Weise gedeckt.
Jodierungsgrad unseres Speisesalzes
Wie viel Jod im Speisesalz enthalten sein darf – der Jodierungsgrad – ist gesetzlich festgelegt. Er liegt derzeit bei 15 bis 25 mg/kg Salz oder 20 µg/g Salz. Die erlaubte Jodmenge wird so festgelegt, dass für gesunde sowie schilddrüsenkranke Menschen keinerlei gesundheitliche Risiken bestehen. Die amtliche Lebensmittelüberwachung hat die Aufgabe, die Einhaltung des gesetzlich festgeschriebenen Jodierungsgrades zu kontrollieren.
Und nein, es gibt auch keine Zwangsjodierung von Lebensmitteln. Ob Privatpersonen, die Gastronomie oder die Lebensmittelproduzenten jodiertes Salz einsetzen, bleibt ihnen überlassen. Der Einsatz ist also freiwillig, wird jedoch aus den genannten Gründen empfohlen.
Bei verpackten Lebensmitteln ist auf der Zutatenliste erkennbar, ob jodiertes Speisesalz eingesetzt wurde oder nicht. Bei losen Produkten wie beispielsweise Brot kann man beim Bäcker nachfragen. Tierische Lebensmittel mit Ausnahme von Seefischen und Meeresfrüchten sind von Natur aus jodarm, enthalten aber Jod, da das Mineral- und Mischfutter für die Nutztierhaltung seit 1990 systematisch mit Jod angereichert wird, um die Tiere vor Jodmangelerkrankungen zu schützen.
Jeder Mensch verträgt Jod
Manche Menschen glauben, dass sie auf Jod allergisch reagieren. Ganz allgemein kann sich eine Allergie immer dann entwickeln, wenn der Körper einen Stoff als fremd und gefährlich einstuft und Antikörper bildet. Dies ist die Phase der Sensibilisierung. Wenn es dann zu einem erneuten Kontakt mit der allergieauslösenden Substanz, dem Allergen, kommt, reagieren die Antikörper damit und lösen die allergischen Beschwerden aus.
Das Element Jod sowie die Anionen Jodid und Jodat sind allerdings sehr klein, sodass sie vom Immunsystem gar nicht wahrgenommen werden. Für eine Sensibilisierung bedarf es einer Molekülgröße im Bereich der Eiweiße. Noch dazu ist der Körper auf Jod angewiesen. Eine Unverträglichkeit von Jod ist mit dem Leben gar nicht vereinbar.
Organische Jodverbindungen, wie man sie zum Beispiel für jodhaltige Röntgenkontrastmittel oder bei der Wundbehandlung einsetzt, können allerdings tatsächlich allergische Reaktionen hervorrufen. Hier spielt allerdings der Rest des Moleküls, an den das Jod gebunden ist, die entscheidende Rolle. Erst dadurch wird die nötige Molekülgröße für eine allergische Reaktion erreicht.
Personen, die auf jodhaltigen Röntgenkontrastmitteln oder jodhaltige Arzneistoffe allergisch reagieren, sollten organische Jodverbindungen meiden, müssen ihre Jodzufuhr über die Nahrung aber nicht einschränken. Sie benötigen Jod in der gleichen Menge wie andere Menschen.
Bekannt sind auch Allergien auf Meeresfrüchte. Sie hängen allerdings gar nicht mit deren Jodgehalt zusammen. Auslöser für die Allergie sind spezielle Fisch- und Weichtierproteine.
Keine größeren Jodmengen bei Schilddrüsenerkrankungen
Bei Patienten mit autonomen Adenomen oder anderen Schilddrüsenautonomien hat eine kurzfristig erhöhte Jodzufuhr in der Regel keine Folgen. Erst eine längerfristig erhöhte Jodaufnahme von über 500 µg pro Tag kann bei diesen Patienten eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Hyperthyreose auslösen. Eine normale Jodaufnahme ist unproblematisch und notwendig.
Patienten mit einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, wie beispielsweise der Hashimoto-Thyreoiditis oder Morbus Basedow, müssen sich ebenfalls nicht jodarm ernähren. Studien zeigen, dass bei ihnen erst eine chronisch erhöhte Jodzufuhr von mehr als 300 µg pro Tag die Entzündungen in der Schilddrüse triggern kann.
Was ist eine Hashimoto-Thyreoiditis?
Darunter versteht man eine chronische Entzündung der Schilddrüse, die im Anfangsstadium zu einer Überfunktion führen kann, im weiteren Verlauf meist zu einer Unterfunktion der Schilddrüse führt. Die Erkrankung ist Folge einer Autoimmunreaktion, bei der Antikörper gegen Schilddrüsengewebe gebildet wird. Sie wird durch genetische Faktoren begünstigt.
Durch die ständige Entzündung kommt es zu einer Vernarbung und Rückbildung der Schilddrüse. Der Verlauf dieser Erkrankung ist sehr langsam, sodass oft erst Jahre oder Jahrzehnte nach der erstmaligen Feststellung von Schilddrüsen-Autoantikörpern eine Unterfunktion der Schilddrüse auftritt. Manchmal bleibt die Funktion auch lebenslang erhalten.
Von den medizinischen Fachgesellschaften werden weder ein Jodverzicht noch eine jodarme Ernährung empfohlen. Auch ist kein Verzicht auf jodiertes Speisesalz erforderlich. Auf zusätzliche Jodaufnahmen, wie zum Beispiel durch jodhaltige Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate, sollte allerdings verzichtet werden.