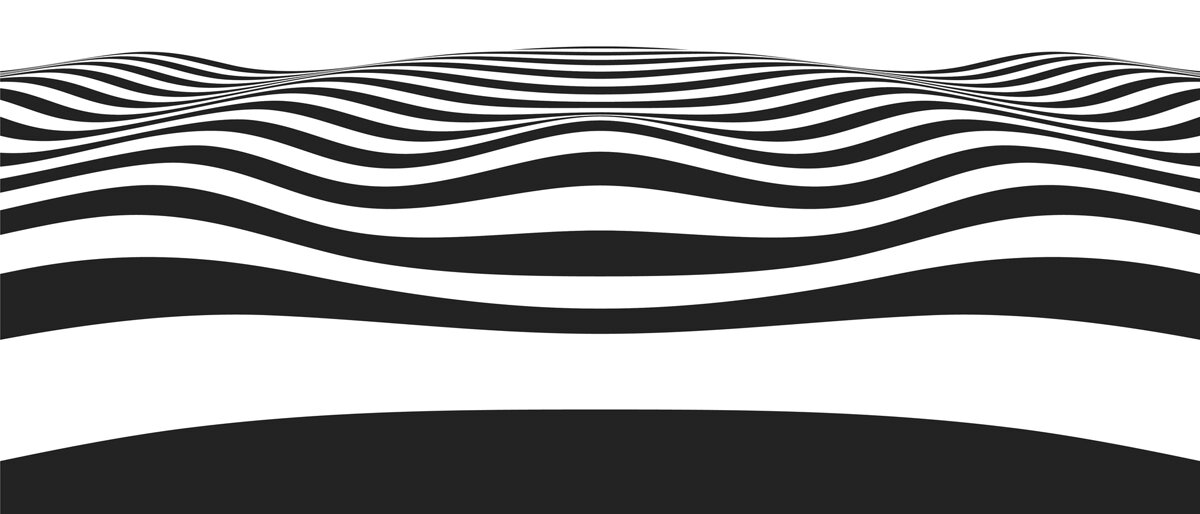Forschung | Proteomik
WIE WEIST MAN EINEN PLACEBO-EFFEKT NACH?
Seite 1/1 2 Minuten
Vor allem das Thema Schmerzen musste bislang herhalten: Die einen bekamen Tabletten, die anderen nicht, sie „wirkten“ trotzdem und Wissenschaftler untersuchten daraufhin die Hirnaktivitäten. Doch die physiologischen Mechanismen hinter dem Phänomen Placebo-Effekt sind immer noch weitestgehend terra incognita. Nun hat ein Team um Karin Meißner vom LMU-Institut für Medizinische Psychologie in Zusammenarbeit mit Forschern des Helmholtz-Zentrums München das Phänomen bei Übelkeit erstmals im Labor auf molekulare Mechanismen hin untersucht. Die Forscher fanden dabei nicht nur Symptomeffekte einer Placebo-Behandlung bestätigt, sondern sie entdeckten sogar physiologische Spuren im Blut, die den Effekt selbst erklären könnten. „Es ist die erste Studie überhaupt, die die Methode der Proteomik, also der Erforschung aller im Körper vorkommenden Proteine, im Kontext eingesetzt hat“, sagt Karin Meißner. „Proteomik bietet einen unvoreingenommenen Blick auf den Placeboeffekt."
Proteomik
Protein-Baupläne werden aus der DNA abgelesen. Die Gesamtheit der im Körper befindlichen Proteine bezeichnet man als Proteom. Es ist abhängig von verschiedenen Faktoren, die beeinflussen, welche Protein-Baupläne gerade aus der Erbsubstanz abgelesen werden.
Übelkeit ist insofern ein passendes wissenschaftliches Sujet als dass es etwa als Nebenwirkung von Medikamenten und Narkosen oder in der Schwangerschaft eine Rolle spielt – und beim Reisen sowieso. „Für mich ist das Symptom der Übelkeit besonders spannend, weil es mit messbaren Änderungen der Magenaktivität einhergeht“, sagt Meißner. Damit lässt sich der Phantom-Effekt auf körperlicher Ebene untersuchen.
Dazu wurden die armen Probanden – 100 an der Zahl – einer Übelkeit erregenden Prozedur unterzogen. Schwarz-weiße Streifen zogen auf einem halbrunden Bildschirm in nur 30 Zentimetern Abstand vorbei. Das ergab einen so genannten Vektionsreiz und den Teilnehmern wurde dabei übel. Die Wissenschaft befragte dann die Menschen im Namen der Forschung nach ihren Symptomen, maßen die Magenaktivität und entnahmen Blutproben.
Der Clou geschah am Tag darauf: Da testete das Team, wie die Probanden auf eine Placebo-Behandlung im Vergleich zu keiner und echter Behandlung reagierten. Bei einer echten Behandlung gegen Übelkeit stimuliert ein TENS-Gerät mit leichtem Strom bestimmte Akupunkturpunkte, woraufhin die Übelkeit verschwindet. Bei einer Placebo-Behandlung findet entweder gar keine oder nur eine oberflächliche, nicht wirksame Behandlung statt.
Und die Wissenschaftler wurden fündig. Sie entdeckten bei ihrer Proteomik-Analyse spezifische Proteine, die mit einer schnellen Immunantwort bei Auftreten von Übelkeit in Verbindung stehen; die Placebo-Behandlung unterdrückt diese nämlich. Zudem gab es auch Hinweise, dass Proteine wie Neurexin oder Reelin, die für empathisches Verhalten und Bindung eine wichtige Rolle spielen, mit dem Placebo-Effekt auf Übelkeit assoziiert waren. Bindungshormone verstärken den Effekt offenbar. Das Phänomen könnte eine evolutionäre Wurzel haben („Lausen in der Gruppe verstärkt im Tierreich die Bindung“), was wiederum den Anstieg bestimmter Hormone bewirkt und damit den Effekt verstärkt.
Die entsprechende Proteinsignatur im Blutplasma führte damit zu einer treffsicheren Genauigkeit der Vorhersage, welcher Proband einen großen Placebo-Effekt entwickeln würde. Bei einem anderen physiologischen Marker – der Magenaktivität bei Männern und Frauen – gab es eine Überraschung. Übelkeit verstärkt diese Aktivität; bei Frauen normalisierte sie sich durch die Placebo-„Behandlung“, bei Männern nicht. „Die Gründe für diesen Geschlechterunterschied sind noch nicht bekannt“, sagt Meißner, „Sie hängen aber möglicherweise mit einer unterschiedlichen körperlichen Anpassung der Geschlechter an Stressreize zusammen.“
Alexandra Regner,
PTA und Journalistin
Quelle: Informationsdienst Wissenschaft