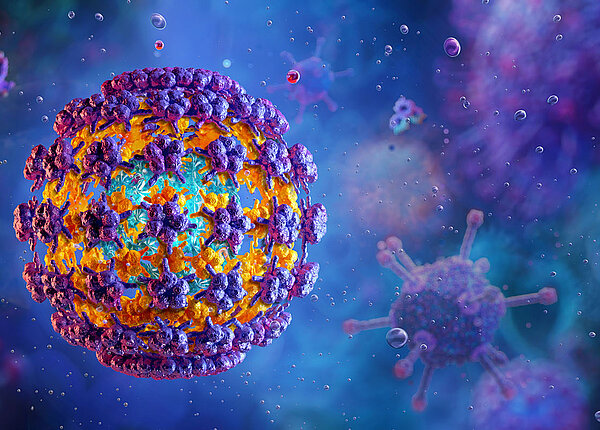Forschung | Hormone
MACHT DAS KUSCHELHORMON OXYTOCIN AGGRESSIV?
Seite 1/1 1 Minute
Der Neurotransmitter Oxytocin wird im Gehirn gebildet und ist maßgeblich am Geburtsprozess beteiligt: Er fördert die Kontraktion der Gebärmutter während der Wehen, die Milchproduktion in den Brustdrüsen und die Bindung zwischen Mutter und Kind. Auch das Verbundenheitsgefühl von Sexualpartnern geht unter anderem auf den Einfluss des Neuropeptids zurück. So wurde ihm bislang ein fördernder Effekt auf soziale Interaktion attestiert. Es wird im autistischen Spektrum und bei der Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen verwendet, so bei sozialen Ängsten und Schizophrenie. Eine Studie zeigte jetzt jedoch, dass Oxytocin nicht nur positiven Einfluss auf das Sozialleben hat.
Die meisten Erkenntnisse zur Wirkung des Hormons stammen von Mäusen, die unter standardisierten Laborbedingungen gehalten wurden - also isoliert. Eine Forschungsgruppe des Weizmann-Instituts für Wissenschaft hat diese Verhaltensstudien nun in eine halbnatürliche Umgebung überführt, um das soziale Miteinander der Tiere in ihre Ergebnisse einzubeziehen. Und sie stellten Erstaunliches fest: Oxytocin kann Aggressionen auslösen.
Acht Jahre lang wurden die Nager rund um die Uhr bewacht und analysiert. Um nicht in die Umgebung der Tiere eingreifen zu müssen, steuerten die Wissenschaftler die Oxytocin-produzierenden Hirnzellen mit Lichtsignalen sanft. So konnten sie die unterschiedlichen Wirkungen des Hormons in Abhängigkeit von den Haltungsbedingungen deutlich beobachten: Die Mäuse in klassischer Laborhaltung wiesen eine verminderte Aggression auf. In der halbnatürlichen Umgebung - mit Konkurrenzsituationen zwischen mehreren Männchen und Auseinandersetzungen um Nahrung - steigerte der Neurotransmitter anfangs das Interesse der Tiere aneinander, verstärkte dann jedoch schnell feindseliges Verhalten.
Die Forscher schließen daraus, dass es sich bei dem "Liebeshormon" doch eher um ein "soziales Hormon" handele, das abhängig von Persönlichkeit und Kontext Verhaltensweisen fördere. Mit diesen neuen Erkenntnissen müsse möglicherweise die pharmazeutische Anwendung neu ausgelotet werden, gab die Veröffentlichung in der Zeitschrift Neuron zu bedenken.
Gesa Van Hecke,
PTA und Redaktionsvolontärin
Quelle: Informationsdienst Wissenschaft