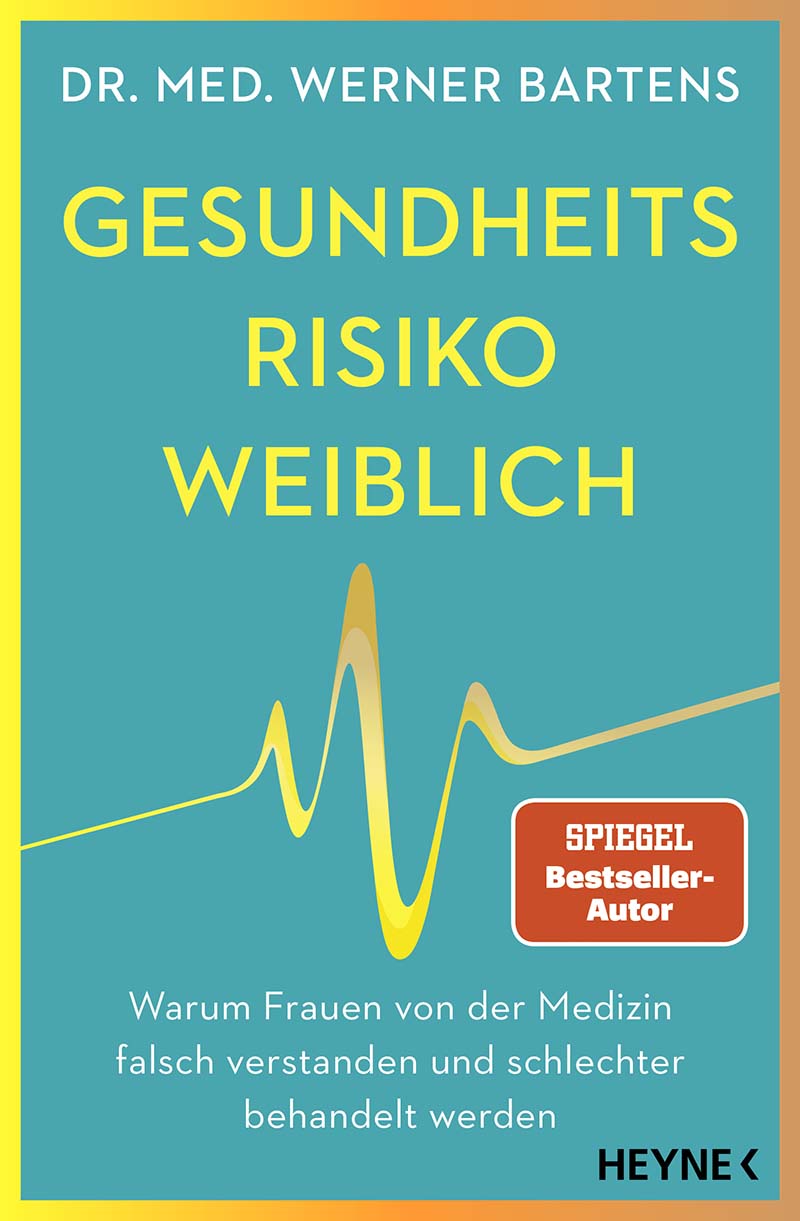Unscharf definiertes Krankheitsbild
MODE- ODER ECHTE DIAGNOSE?
Seite 1/1 10 Minuten
Kommen Ihnen diese Sätze bekannt vor? „Das höre ich in letzter Zeit dauernd. Das hat jetzt wohl jeder“ oder „Gut, dass ich das gelesen habe; ich glaube ich habe das auch.“ Vielleicht haben Sie bemerkt, dass immer mehr Menschen von bestimmten Krankheiten sprechen, die früher kaum bekannt waren Scheinbare Erkrankungen, die eine Zeit lang viel mediale Aufmerksamkeit erhalten, nennt man Modediagnosen.
Darunter sind Befindlichkeitsstörungen, die genau genommen keinen Krankheitswert haben, oder auch angeblich neu entdeckte Syndrome, denen aber die wissenschaftliche Grundlage fehlt. Viele Krankheiten, die wir leicht als eine solche Modediagnose abtun, sind jedoch ernstzunehmende Leiden. Dafür, dass sie zeitweise so präsent sind, gibt es Gründe. Hier gilt es also, genau hinzuschauen und dass eine vom anderen zu unterscheiden.
Definition Fehlanzeige
Typisch für Modediagnosen ist eine schwammige Definition des Krankheitsbildes. Sie werden selten etwas zu genauen Mechanismen und spezifischen Symptomen lesen. Je ungenauer die Erkrankung umrissen ist, desto mehr Menschen können ihre eigenen Beschwerden auf das Krankheitsbild projizieren, können sich mit der Modediagnose identifizieren. Das führt dann zu Das-habe-ich-bestimmt-auch-Momenten. Und wer sich betroffen glaubt, spricht eher darüber – so bekommt die Krankheit immer mehr Aufmerksamkeit.
Diese Aufmerksamkeit ist ein weiteres Kennzeichen einer Modediagnose: Sie wird eine Zeit lang medial diskutiert. Es ist dann schwierig, eine neu erfundene Modediagnose von einer tatsächlichen medizinischen Erkenntnis zu unterscheiden – besonders für Laien.
Auch das sogenannte Disease Mongering ist typisch für eine Modediagnose: etwas Normales als krankhaft umetikettieren. Sogenannte Disease-Awareness-Kampagnen verbreiten Informationen zur scheinbar neuen Krankheit. Oft veranlassen das diejenigen, die an der Erkrankung verdienen, etwa, weil sie Therapien oder Arzneimittel dagegen anbieten. Die Alternativmedizin profitiert vom Disease Mongering, indem sie Nahrungsergänzungsmittel, Verfahren und Behandlungen gegen Befindlichkeiten anbietet, die eigentlich keine Krankheit sind.
Ein anderes Beispiel hierfür ist das wiederholte Herabsenken der Grenzwerte für Blutfette bezüglich des LDL-Wertes: Je niedriger die Werte, desto mehr Patienten gibt es, die Medikamente, also in diesem Fall Statine benötigen. Die wissenschaftliche Grundlage für die neuen, niedrigen Grenzen sind Studien, die von den Pharmafirmen finanziert werden.
Ein großer Treiber für Modediagnosen ist auch die Angst vor (technischen) Neuerungen. Detox etwa fußt auf der Angst, im Körper könnten sich schädliche Substanzen oder Stoffwechselprodukte ansammeln. Die wissenschaftliche Grundlage für solche Annahmen fehlt, aber Nahrungsergänzungsmittel, Entschlackungskuren und Detox-Programme boomen. Die sogenannte Multiple Chemikaliensensitivität zum Beispiel soll eine schleichende Vergiftung mit Chemikalien aller Art sein. Viele fürchten auch, durch das 5G-Netz krank zu werden oder durch Chemikalien, die Verschwörungserzählungen nach in den Kondensstreifen von Flugzeugen enthalten sein sollen (sogenannte Chemtrails).
Die Darmkrankheit Leaky Gut ist der Versuch, verschiedene Symptome, Anomalien und Befunde zu erklären, die scheinbar häufig gleichzeitig auftreten: Schmerzen, unspezifische Verdauungsbeschwerden, Stimmungsschwankungen, Hautprobleme und eine hohe Infektanfälligkeit. Eine gestörte Darmbarriere soll zu chronischen Entzündungen führen, die all diese Beschwerden erklären. Obwohl die Hypothese zum Krankheitsgeschehen plausibel klingt und sogar spezifische Botenstoffe und Mechanismen benennt, fehlen Belege für die Existenz des Leaky-Gut-Syndroms. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz.
Es ist zwar erwiesen, dass die Darmbarriere im Anfangsstadium einer Zöliakie geöffnet ist und dass chronisch-entzündliche Darmerkrankungen mit einer gestörten Darmbarriere einhergehen. Was hiervon aber Ursache und was Folge ist, ist noch unklar. Es ist nachvollziehbar, dass Betroffene eine einzelne, zugrundeliegende Ursache für all ihre Beschwerden finden wollen, aber medizinisch ist das unwahrscheinlich.
Die Sache mit der Wahrnehmung
Ob nun Mode- oder echte Diagnose: Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass bestimmte Krankheiten plötzlich andauernd auftreten. Wohin man hört, liest oder schaut, ist von dieser Krankheit die Rede. Dabei stellt sich aber die Frage: Tritt die Krankheit wirklich häufiger auf? Oder richten wir nur unser Bewusstsein stärker auf sie?
Eine mögliche Erklärung ist das Baader-Meinhof-Phänomen, eine kognitive Täuschung. Es beschreibt den Effekt, dass wir etwas Neues erfahren und dann jedes Mal, wenn uns die gelernte Sache über den Weg läuft, einen Aha-Moment erleben. Wir haben dann den Eindruck, dass diese bestimmte Sache ganz plötzlich überall auftauche. In Wahrheit aber war sie auch vorher schon präsent, wir haben sie nur nicht beachtet.
„Beim Baader-Meinhof-Phänomen handelt es sich um eine kognitive Verzerrung, die ein vermehrtes Auftreten des Gegenstandes suggerier“.
Zudem sind Informationen und Medien heute einer breiteren Masse zugänglich und schneller verfügbar als jemals zuvor. So können sich Trends schneller entwickeln und verbreiten, auch in Sachen Krankheiten. Und da es immer mehr Medien gibt und wir immer mehr Dinge online erledigen, haben wir auch immer mehr Berührungspunkte in unserem privaten und beruflichen Alltag mit den Themen, die gerade kursieren.
Statt also nur morgens die Zeitung zu lesen, im Auto Radio zu hören und abends fernzusehen, sind wir heute auch über unsere Smartphones und über den Arbeits-Computer ständig mit neuen Informationen konfrontiert. So haben wir mehr Gelegenheiten, auf ein Thema aufmerksam zu werden. Außerdem spielt bei solchen Trends auch die Awareness eine Rolle, also die Aufmerksamkeit, die Betroffene und Organisationen gezielt für die Krankheit schaffen.
Die Sozialen Medien bieten jedermann eine Plattform, über die Dinge zu sprechen, die ihn bewegen. So kommen mehr Betroffene zu Wort – nicht bloß als Gesprächspartner oder Fallbeispiele in Beiträgen größerer Medien, wie es vor einigen Jahrzehnten noch der Fall war. Und Betroffenen- und Angehörigen-Organisationen initiieren immer wieder Kampagnen, um auf bestimmte Krankheitsbilder aufmerksam zu machen und so den Blick auf Mangelbereiche zu lenken – Forschungsgelder etwa, Diagnose- und Therapieplätze oder Dinge des Alltags, die zum Beispiel die Barrierefreiheit betreffen.
Aufmerksamer Algorithmus
Unabhängig davon, ob ein Thema online wirklich präsenter ist als früher, ist es auch möglich, dass nur Sie vermehrt Inhalte dazu sehen. Das liegt an den Algorithmen der Werbetreibenden, Suchmaschinen und Sozialen Netzwerke. Ihre Aufmerksamkeit ist die Währung, in der sie ihren Erfolg messen. Deshalb werten sie aus, was Sie anklicken, bei welchen Themen Sie schnell weiterscrollen, nach welchen Begriffen Sie suchen und was Sie online einkaufen. Daraus errechnen Algorithmen, was Sie interessiert – und spielen Ihnen bevorzugt Beiträge, Werbung oder „Das könnte Sie auch interessieren“-Artikel zu diesen Themen aus.
Noch vor wenigen Jahren bekamen Sie in Sozialen Netzwerken angezeigt, was die Personen gepostet haben, denen Sie folgen. Also vor allem Ihre Bekannten, die sich zu ihren vielfältigen Interessen äußern oder von ihrem Alltag berichten. Heute sehen Sie im Netz hauptsächlich Inhalte, die Algorithmen für Sie auswählen.
Das heißt, wenn Sie einen Artikel zu einer Krankheit aufmerksam lesen, sehen Sie in nächster Zeit viele weitere Artikel darüber; außerdem zum Beispiel Erfahrungsberichte von Betroffenen als Social-Media-Post oder auch Werbung für Nahrungsergänzungsmittel, die bei dieser Erkrankung helfen sollen. So entsteht der verzerrte Eindruck, das Internet drehe sich nur noch um ein Thema.
Hysterie und Eisenbahnkrankheit
Modediagnosen sind, auch wenn sie sich heute schneller verbreiten, kein Trend des 21. Jahrhunderts. Als die Eisenbahn zum populären Transportmittel wurde, dauerte es nicht lange, bis auch von einer Eisenbahnkrankheit die Rede war: Wer häufig Zug fuhr, litt danach an Verdauungsstörungen, war nervös und erschöpft, so die Theorie.
Die Neurasthenie war Ende des 19. Jahrhunderts eine ähnliche, beliebte Diagnose: Elektrizität, Industrie und das schnellere Lebenstempo sollten Reizüberempfindlichkeit, Erschöpfung und Muskelschmerzen auslösen. Hier wurden also jeweils rein physische Ursachen für psychische oder psychosomatische Beschwerden gesucht. Und die Angst vor den technischen Innovationen der Zeit mündete darin, dass man ihnen einen krankmachenden Effekt zuschrieb – ähnlich wie Verschwörungserzählungen zum 5G-Netz heute.
Diagnosen der Zeit
Modediagnosen sind mehr Ausdruck des Zeitgeschehens und der typischen Ängste einer Ära als tatsächliche Erkrankungen. Daneben existieren die „echten“ Diagnosen, die typisch für eine Zeit sind: Computerspielsucht etwa. Die WHO hat sie im Diagnosekatalog ICD-11 in Bereich der mentalen, Verhaltens- und Neuroentwicklungsstörungen eingeordnet und bezeichnet sie als substanzungebundene Abhängigkeit.
Vor 100 Jahren wäre allein der Begriff Computerspielsucht undenkbar gewesen; die Geräte mussten erst erfunden und der breiten Masse zugänglich werden, bevor sich die Krankheit entwickeln und dann als solche anerkannt werden konnte. Auch Long-COVID können wir hierzu zählen – vor der COVID-19-Pandemie gab es kein Long-COVID. Krankheiten können also Zeichen ihrer Zeit, gleichzeitig aber keine Modediagnose sein.
Ähnliches ist auch aus noch früheren Zeiten bekannt. So lautete der Befund bei Frauen mit plötzlicher Atemnot im 17. Jahrhundert oft Gebärmuttererstickung. Man dachte damals, der Uterus wandere frei im Körper umher, könne dabei auf die Atemwege drücken und Erstickungsanfälle auslösen. Heute würden wir viele dieser Vorfälle als Panikattacken erklären. Oder die Hysterie: Den Begriff kennen Sie bestimmt. Wir nennen jemanden hysterisch, der überspannt handelt, der übertrieben reagiert.
Der Wortbestandteil „hyster-“ bedeutet aber Gebärmutter und die Hysterie als Krankheit geht auf den Gedanken zurück, dass die Gebärmutter, „wenn sie nicht regelmäßig mit Samen gefüttert werde“ suchend im Körper umherirre und sich letztlich im Gehirn festbeiße. Mit Hysterie diagnostizierte man gern eine psychische Erkrankung bei kinderlosen Frauen mit ungewöhnlichen oder unbequemen Ansichten. Gebärmuttererstickung und Hysterie zeigen beispielhaft auf, dass viele Modediagnosen speziell Frauen betreffen.
Frauen in der Medizin
Die Medizin orientiert sich bis heute vor allem am männlichen Körper. Die Vergleichswerte für Blutuntersuchungen gelten für Männer, Standarddosierungen für Medikamente gelten für Männer und die Symptome, anhand derer eine Krankheit festgestellt wird, treffen überwiegend auf männliche Erkrankte zu. Wesentliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, etwa in Sachen Körperbau, Hormonlage und Stoffwechsel, wurden lange gar nicht untersucht oder ignoriert. Zudem wurden und werden Patientinnen weniger ernst genommen als Patienten, wenn sie ihre Beschwerden schildern. Das führt dazu, dass Erkrankungen als Bagatelle abgetan werden, dass statt der eigentlichen Ursache psychische Erkrankungen diagnostiziert werden und dass Diagnosen später gestellt werden. Dr. Werner Bartens, Arzt, Forscher und Autor, schreibt dazu: „Frauen sind nicht nur anders krank als Männer, sie haben nicht nur andere Beschwerden, Einschränkungen, Schmerzen und Bedürfnisse, sondern mit ihnen wird in der Medizin auch anders geredet.“ Er hat dem Thema ein ganzes Buch gewidmet (s. Kasten).
Männliche Medizin
„Medizin ist nicht neutral. Sie wird von Menschen gemacht, und Menschen haben Vorurteile“, schreibt Dr. med. Werner Bartens in „Gesundheitsrisiko weiblich“. Er sagt, eigentlich müsse es der Medizin heißen, nicht die Medizin. Denn bis heute entstehen Frauen allein durch ihr Geschlecht Nachteile in der medizinischen Versorgung – egal, welches Organ betroffen ist, ob sie eine Impfung oder Operation benötigen. Bartens erklärt, inwiefern Frauen anders krank werden als Männer, wie die Forschung Frauen außen vorlässt und woran es bei der Kommunikation zwischen Arzt und Patientin hapert. Praktisch: Im Sachregister am Ende können Sie von A wie Abdominelle Fettleibigkeit bis Z wie Zytokine nachschlagen, wo „der Medizin“ noch Nachholbedarf hat.
Dr. med. Werner Bartens
Gesundheitsrisiko weiblich – Warum Frauen von der Medizin falsch verstanden und schlechter behandelt werden
Paperback Heyne Verlag, 288 Seiten, 20 Euro
ISBN 978-3453218383
Die physiologischen Unterschiede der Geschlechter rückt zum Glück immer weiter in den Fokus. Das bedeutet auch, dass Frauen jetzt Diagnosen für Erkrankungen erhalten, mit denen sie schon lange leben, bei denen sie bislang aber durch die Diagnoseraster fielen, weil diese überwiegend männliche Symptome listeten. Oder dass jetzt frauentypische Krankheiten diagnostiziert werden, deren Beschwerden in der Vergangenheit als normal abgetan wurden. Da Frauen, wenn sie von ihren Erfahrungen berichten, in der Öffentlichkeit aber immer noch oft nicht ernst genommen werden, werden die vermehrt diagnostizierten Krankheiten als Modediagnosen abgetan.
Aktuelle Beispiele hierfür sind ADHS, Lipödem und Endometriose. Die Beschwerden bei Endometriose werden oft als „normale“ Regelschmerzen abgetan, das Lipödem als Übergewicht. Die Diagnosekriterien für ADHS umfassen Impulsivität, Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität – der typische Zappelphilipp. Kein Wunder, denn die Kriterien wurden für die Diagnose von Kindern im Schulalter geschaffen. Sie dienen der Einordnung verhaltensauffälliger Kinder, die den Unterricht stören.
Mädchen im Schulalter fallen oft durch dieses Raster, da ihr ADHS weniger augenscheinlich ist; sie stören nicht. Sie gelten eher als verträumt statt unaufmerksam, redselig statt hyperaktiv und tragen ihre Unruhe im Inneren. Von ihnen wird gesellschaftlich erwartet, nicht zu wild zu sein. Viele unterdrücken ihre Symptome deshalb jahrelang unbewusst, wollen funktionieren – und suchen erst im Erwachsenenalter psychologische Hilfe, wenn Folgeerkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen sie einschränken.
Mehr Aufmerksamkeit, mehr Diagnosen?
Durch den medialen Fokus auf diese Erkrankungen fällt es Betroffenen leichter, ihre Symptome einzuordnen und beim Arzt anzusprechen. Das heißt aber nicht automatisch, dass dadurch auch mehr Diagnosen gestellt würden. Einige Erkrankungen, wie ADHS, werden nur in spezialisierten Praxen oder in Ambulanz-Sprechstunden an Universitätskliniken festgestellt – und deren Wartelisten sind monate- bis jahrelang.
Bei anderen Krankheiten wie dem rheumatischen Schmerzsyndrom Fibromyalgie handelt es sich um eine Ausschlussdiagnose; bevor ein Arzt die Erkrankung feststellt, gehen ebenfalls oft Jahre ins Land, weil zuerst alle anderen möglichen Ursachen überprüft und ausgeräumt werden müssen.
Gleichzeitig reagieren einige Ärzte zögerlich, wenn ihre Patienten äußern, vielleicht eine Erkrankung zu haben, die aktuell durch die Medien geht. Sie vermuten, dass ihr Patient bloß auf einen Trend – eben eine Modediagnose, aufspringt, und versagen womöglich sogar Untersuchungen. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass die Medienpräsenz einer Krankheit Ärzte auf das Beschwerdebild aufmerksam macht. Wer am Vorabend einen Artikel über Burn-out gelesen hat, wird am nächsten Tag bei erschöpften Patienten vielleicht hellhörig.
Werden von einer Erkrankung tatsächlich mehr Diagnosen gestellt, muss das nicht allein an dem gesteigerten Bewusstsein liegen. Es könnte auch auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgehen. Etwa, weil Genmarker es jetzt erlauben, Erkrankungen besser voneinander abzugrenzen, oder weil andere, neue Untersuchungsmethoden eine genauere Einschätzung erlauben. Oder weil die ärztlichen Klassifikationssysteme (ICD- und DSM-Katalog) ihre Diagnosekriterien aktualisiert haben – das passiert zum Beispiel dann, wenn Krankheiten besser untersucht werden und sich neue Informationen über ihre typischen Beschwerden und deren Häufigkeit ergeben.
Bitte nicht mit Simulanten verwechseln
Wer glaubt eine Modekrankheit zu haben, hat echte Beschwerden. Auch wenn es das Krankheitsbild, unter dem die Betroffenen zu leiden glauben, nicht gibt, sind die Symptome doch vorhanden – nur die Diagnose stimmt nicht. Nehmen Sie Kundinnen und Kunden ernst. Tun Sie sie nicht als Simulanten oder Hypochonder ab, sondern helfen Sie Ihnen auf dem Weg zur richtigen Diagnose.