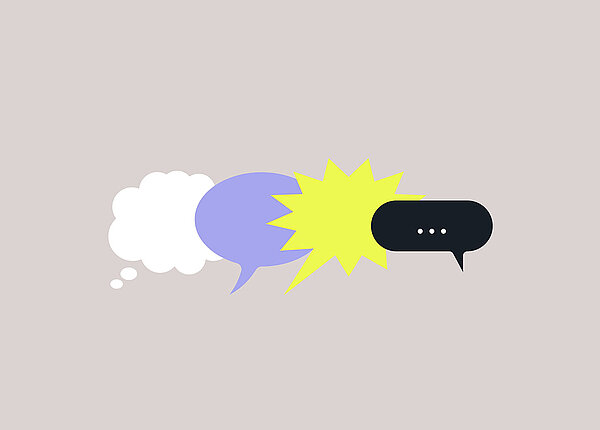PTA-Fortbildung 11/14
DEPRESSION: GRAU IN GRAU
Seite 1/1 14 Minuten
Nach Schätzungen der WHO leiden drei bis fünf Prozent der Weltbevölkerung an Depressionen, das sind etwa 200 Millionen Menschen. Dabei handelt es sich nur um die von Fachleuten diagnostizierten und behandelten Krankheitsfälle, in Wahrheit dürfte die Zahl noch höher liegen. In Deutschland leiden etwa fünf Prozent an einer depressiven Störung, also etwa vier Millionen Bundesbürger – darunter nicht wenige prominente Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kunst, Medien und Sport.
Frauen leiden häufiger unter typischen Depressionssymptomen als Männer. Man geht heute davon aus, dass Letztere genauso häufig depressiv sind. Bei ihnen äußert sich dies aber eher verdeckt in Form von Arbeitswut, Sportsucht, Alkoholmissbrauch oder einem riskanten, aggressiven Lebensstil. Der Verlauf depressiver Störungen kann ganz unterschiedlich sein. Manche Patienten erleiden in ihrem Leben nur eine einzige depressive Episode, bei anderen treten sie wiederholt auf.
Für die Prognose ist es sehr wichtig, dass nach dem Abklingen einer depressiven Episode die normale Stimmung wiederhergestellt wird. Unvollständige Remissionen gehen nämlich mit einem wesentlich erhöhten Risiko einher, eine weitere depressive Episode zu erleiden. Zu den Folgen depressiver Erkrankungen zählen neben dem Leiden der Betroffenen auch die Konsequenzen der Erkrankung für Partner, Angehörige und soziales Umfeld, die zeitweise Arbeitsunfähigkeit und der häufig frühzeitige Eintritt in die Rente. Zudem besteht ein ausgeprägtes Suizidrisiko.
Nur mies drauf? Jeder Mensch durchlebt irgendwann einmal schwierige Phasen, in denen er deprimiert ist. Meist haben solche Stimmungsschwankungen einen konkreten Anlass. Dann fühlt man sich traurig und mutlos, hat keine Energie mehr und möchte sich am liebsten verkriechen. Das ist ein ganz normales und der Situation angemessenes Verhalten. Jeder kann dies unterschiedlich intensiv erleben. In den meisten Fällen vergeht dieses Gefühl mit der Zeit von allein. In der Regel hält es ein bis zwei Wochen an, dann kommen die positiven Empfindungen wieder. Selbst Phasen der Trauer werden nach einigen Monaten schwächer. Sport, ein künstlerisches Hobby oder soziale Aktivitäten können vielen bei der Überwindung helfen.
Depressiv verstimmt Eine depressive Verstimmung unterscheidet sich von normaler Trauer und normalem Deprimiertsein. Die Gefühle der Niedergeschlagenheit, Traurigkeit und inneren Leere sind stärker ausgeprägt und halten länger an. Die Zahl depressiv verstimmter und depressiver Menschen steigt. Dafür scheint es mehrere Ursachen zu geben. Zum einen werden depressive Verstimmungen und Depressionen heute einfach häufiger erkannt. Zum anderen haben sich unsere Lebensbedingungen verändert, neben den sozialen Strukturen ist hier ganz besonders der zunehmende Leistungsdruck zu nennen. Bei vielen beginnt er schon im Schulkindalter und setzt sich im Arbeitsleben fort.
WINTERDEPRESSION
Tritt ein seelisches Tief regelmäßig in den lichtärmeren Herbst- und Wintermonaten auf, kann es sich um eine Winterdepression handeln. Als Ursache wird der gestörte biologische Tagesrhythmus durch den Mangel an natürlichem Licht angesehen. Betroffene sind nicht zwangsläufig niedergeschlagen und traurig, sondern vor allem müde, abgeschlagen und lustlos. Typisch sind auch Heißhunger auf Süßes und ein erhöhtes Schlafbedürfnis. In den meisten Fällen helfen bereits regelmäßige Spaziergänge in der Mittagssonne. In schweren Fällen ist eine medikamentöse Therapie erforderlich.
Nach von den Krankenkassen erhobenen Daten scheinen jüngere Menschen heute gefährdeter zu sein, im Laufe ihres Lebens eine depressive Erkrankung zu erleiden als dies in anderen Generationen der Fall war. Auch dies kann man mit den veränderten Anforderungen in Schule und Beruf erklären. Gibt es ausreichend Erholungspausen, so haben die meisten Menschen genügend Energie, stressige Zeiten ohne Folgen zu überstehen. Hält die Belastung aber dauerhaft an, entwickelt sich schnell ein Gefühl der Überforderung, das dann in ein anhaltendes Stimmungstief übergehen kann. Jetzt kommen Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit hinzu und alltägliche Aufgaben sind kaum noch zu meistern.
Jede Unternehmung, selbst ein Besuch bei Freunden, kostet viel Kraft und wird deshalb lieber vermieden. Der soziale Rückzug verstärkt das Seelentief noch weiter. Unbehandelt kann sich aus einer depressiven Verstimmung eine Erschöpfungsdepression entwickeln.
Depressiv Auch wenn der Unterschied zwischen einer depressiven Verstimmung und einer Depression fließend ist, ist Letztere klar definiert. Sie ist durch verschiedene psychische, psychomotorische und somatische Symptome gekennzeichnet. Leitsymptome sind gedrückte Stimmung, Traurigkeit, Interesse-, Freud- und Antrieblosigkeit. Häufig kommen geringe Konzentrationsfähigkeit, häufiges Grübeln, Schuldgefühle, Mangel an Selbstwertgefühl, das Gefühl keine Zukunftsperspektiven zu haben, die Unfähigkeit Entscheidungen zu treffen und Schlafstörungen, Appetitverminderung und Selbstschädigungen dazu.
Um die Diagnose Depression oder wie es heute heißt „Depressive Episode“ zu stellen, müssen nach der ICD-10-Klassifizierung mindestens zwei der Leitsymptome und zwei bis vier der übrigen Symptome über mindesten zwei Wochen vorhanden sein. Zu den somatischen Symptomen, die zusätzlich auftreten können, zählen frühmorgendliches Erwachen, und zwar mindestens zwei Stunden vor der üblichen Zeit, morgendliches Stimmungstief, das Gefühl der Kraftlosigkeit, mangelnde Gefühlsbeteiligung und Libidoverlust.
Depression ist nicht gleich Depression Nicht nur die Ursachen, auch die Symptome und der Krankheitsverlauf können bei einer Depression ganz unterschiedlich sein. Die Klassifikation erfolgt zumeist in endogene, somatogene und psychogene Depressionen sowie Depressionen aufgrund besonderer Lebenslagen. Von der endogenen Depression spricht man, wenn es weder eine körperliche, noch eine psychische Ursache für die Depression zu geben scheint.
Innerhalb der endogenen Depression wird nochmals eine Unterscheidung in unipolar oder die bipolar vorgenommen. Allgemein kennzeichnen sich endogene Depressionen dadurch, dass es einen phasenhaften Verlauf gibt. Die unipolare Depression zeigt sich meist in Form der klassischen Melancholie. Ihren Namen hat sie, da sie einpolig ist, das heißt, die Betroffenen haben nur depressive, aber keine manischen Phasen. Bei der bipolaren Depression gibt es neben den depressiven auch manische Phasen, in denen die Erkrankten unkontrolliert antriebsgesteigert sind.
Die somatogenen Depressionen treten als psychische Begleitsymptome anderer Erkrankungen auf. Dies können neurologische Krankheiten, wie Demenz, Epilepsie, AIDS, Migräne, Multiple Sklerose, Hirntumoren, Morbus Parkinson und zerebrale Durchblutungsstörungen, aber auch Schilddrüsenerkrankungen oder Morbus Cushing als endokrine Störungen sein. Auch bestimmte Medikamente können depressionsauslösend wirken. So ist dies von einigen Bluthochdruckmitteln, zum Beispiel Reserpin, Kortikosteroiden, älteren oralen Kontrazeptiva, Antiepileptika, Neuroleptika, Hypnotika und Zytostatika bekannt.
Die psychogenen Depressionen sind jene, bei denen ein deutlicher Zusammenhang zwischen einem Auslöser und der depressiven Symptomatik besteht. Häufig ist dies schon für Außenstehende offensichtlich. Man unterscheidet die reaktive Depression, die depressive Entwicklung sowie die neurotische Depression. Die reaktive Depression tritt beispielsweise nach dem Tod eines Angehörigen, nach einem selbstverschuldeten Unfall oder nach einem Schwangerschaftsabbruch auf. Auch reaktiv-depressive Verstimmungen in Trennungssituationen oder nach der Mitteilung einer schlechten medizinischen Diagnose sind häufig. Manchmal bewirken diese Auslöser den Verlust des Lebenskonzeptes, beispielsweise wenn nach einer Krebsdiagnose oder infolge längerer Arbeitslosigkeit der bisherige Lebensplan aufgegeben werden muss.
Die depressive Entwicklung, die auch als Erschöpfungsdepression bezeichnet wird, entsteht unter einem chronischen affektiv-emotionalen Druck und äußert sich zunächst meist durch somatische Beschwerden. So sind Schlafstörungen oder auch Rückenschmerzen sehr oft die Folge von Dauerbelastungen. Dabei ist nicht körperlicher Stress der auslösende Faktor, sondern der chronische emotionale Druck. Dies kann ein jahrelang anhaltender Beziehungskrieg sein oder eine chronisch schwierige Arbeitssituation.
Unter einer neurotischen Depression versteht man einen depressiven Zustand, der infolge einer Störung der psychischen Erlebnisverarbeitung entsteht. Hier liegen in der Lebensgeschichte erworbene neurotische Problemlösungsstrategien und ein auslösendes Ereignis zugrunde.
Besondere Lebenslagen Häufig treten Depressionen erstmalig in bestimmten Situationen auf. Am bekanntesten ist wohl die Wochenbettdepression. Nicht jede Mutter, die ein Kind zur Welt bringt, kann sich uneingeschränkt darüber freuen. Zwischen 10 und 15 Prozent der Frauen entwickeln eine Depression, die man wegen ihres Beginns, nämlich innerhalb von vier Wochen nach der Geburt, als postpartale Depression (PPD) oder Wochenbettdepression bezeichnet.
RESILIENZ
Positive Erfahrungen in der Kindheit können das Risiko, an einer Depression zu erkranken, vermindern. Stabile Beziehungen, ein robustes Selbstwertgefühl und die Fähigkeit, in Belastungssituationen gelassen zu bleiben, verhelfen zu einer gewissen Dickfelligkeit, die weniger anfällig für Depressionen macht. Dies wird als Resilienz bezeichnet. Wenn man sich nach Kränkungen, Verletzungen oder Misserfolgen zurückzieht, den Fehler bei sich sucht, Aktivitäten unterlässt, Pläne aufgibt und sein Selbstbewusstsein auf nur einen Pfeiler, etwa die Partnerschaft oder den Beruf gründet, dann kann man, vor allem bei der entsprechenden genetischen Disposition, durch eine belastende Veränderung im Leben leichter aus der Bahn geworfen werden.
Charakteristische Symptome sind gedrückte Stimmung, Interessen- und Appetitverlust, Schlafstörungen, erhöhte Ermüdbarkeit, Wertlosigkeits- und Schuldgefühle, verminderte Konzentrationsfähigkeit sowie Suizidgedanken und -handlungen. Mindestens fünf Symptome müssen über mindestens zwei Wochen vorhanden sein, um die Diagnose einer PPD zu stellen. Die Symptome der PPD werden oft spät oder gar nicht erkannt, denn viele Frauen verschweigen ihre Symptome aus Scham. Dass die Symptome meist erst nach der Entlassung aus der Klinik auftreten, erschwert die Diagnose zusätzlich.
Werden die Probleme vom sozialen Umfeld oder vom Gynäkologen, Kinderarzt oder der Nachsorgehebamme nicht erkannt, können schwerwiegende Komplikationen bei Mutter und Kind auftreten. Die Nichtbehandlung einer Wochenbettdepression ist mit Chronifizierung oder Suizid verbunden. Beim Säugling können Bindungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten sowie Störungen der emotionalen und kognitiven Entwicklung die Folge sein.
»Die Depression ist eine Krankheit der „Losigkeit“. Betroffene fühlten sich emotionslos, freudlos, lustlos und außerdem schlaflos und antriebslos.«
Ein wichtiger Risikofaktor für PPD ist eine depressive oder andere psychische Erkrankungen in der Vorgeschichte. Darüber hinaus werden traumatische Erlebnisse und Vernachlässigung in der eigenen Kindheit, Stressbelastung in der Schwangerschaft, traumatisches Erleben der Geburt, biologische Auslöser (z. B. Hypothyreose), sozioökonomische Faktoren, geringe oder keine soziale Unterstützung sowie geringe Partnerschaftszufriedenheit diskutiert. Bildungsstand, Geschlecht des Kindes oder Stillen scheinen hingegen keinen Einfluss zu haben.
Für die Entstehung einer postpartalen Depression scheint der Estrogenabfall nach der Geburt von Bedeutung zu sein, der sich auf das serotonerge System auswirkt. Aber auch psychosoziale Fragen spielen möglicherweise eine Rolle. Dazu zählen Rückbildungsvorgänge, Umstellung auf die Aufgaben des Mutterseins, Veränderung des Selbst- und Körperbilds sowie Übergang zu einer neuen Beziehungsstruktur.
Abzugrenzen ist die PPD gegen den postpartalen Blues oder Baby Blues. Er geht mit leichten depressiven Verstimmungen, Traurigkeit, Stimmungslabilität und Irritierbarkeit einher und tritt bei 25 bis 50 Prozent aller jungen Mütter in den ersten Wochen nach der Geburt auf. Meist verschwindet er spontan innerhalb weniger Stunden oder Tage.
Klimakterische Depressionen treten bei der Frau erstmals mit den Wechseljahren, beim Mann etwa zwischen dem 50. und dem 65. Lebensjahr auf. Hier sind neben hormonellen Umstellungsprozessen häufig auch psychologische Veränderungen in der Partnerbeziehung, zu den Kindern und in der eigenen Lebenskonzeption zu bewältigen. Unabhängig von der Zuordnung zu endogenen oder reaktiven Depressionsformen bezeichnet man Depressionen, die erstmals in höherem Lebensalter auftreten, als Altersdepression. Jeder siebte bis achte Mensch jenseits des 65. Lebensjahres soll davon betroffen sein. In Einrichtungen, wie Alters- und Pflegeheimen soll der Anteil noch höher sein. Damit wäre nicht die Demenzerkrankung die häufigste psychische Störung in höherem Lebensalter, sondern die Depression, die sich als Reaktion auf die Lebenssituation und häufig auch als langdauernde Trauerreaktion zeigt.
Alte Menschen können ihre Einstellungen und ihre Lebenskonzepte weniger schnell ändern als junge. Sie müssen vom Vergangenen Abschied nehmen, auch von Wünschen und Fantasien, die sich nicht verwirklichen ließen. Dazu kommt häufig die Abhängigkeit von der jüngeren Generation, manchmal auch das Gefühl des Abgeschobenseins oder auch die reale Erfahrung der Vereinsamung. Bei Betroffenen ist die depressive Herabgestimmtheit allerdings oftmals nicht so rasch zu spüren, denn die Generation der heutigen Senioren hat vielfach noch gelernt, keine Gefühle zu zeigen. Daher wird die Depression im Alter oftmals nicht erkannt oder als vorzeitiger Hirnabbau diagnostiziert.
Vulnerabel Es gibt sowohl genetische, als auch konstitutionelle Gründe, weshalb manche Personen an Depressionen erkranken und andere, die vergleichbare Situationen durchleben, nicht. Menschen mit einem höheren Risiko sind verletzlicher. Man bezeichnet diese Verletzlichkeit als Vulnerabilität. Dabei lässt sich eine familiäre Häufung depressiver Erkrankungen nachweisen. Man geht davon aus, dass eine gewisse Anfälligkeit für die Erkrankung vererbt wird.
PSYCHOTHERAPIE
Die Auslöser einer depressiven Erkrankung sind fast immer belastende Veränderungen zwischenmenschlicher Beziehungen. Daher ist das Mittel der ersten Wahl die Psychotherapie bei einem erfahrenen Therapeuten. Eine gute Psychotherapie kann das Risiko einer neuen Episode senken.
Neben der genetischen Veranlagung haben offenbar frühkindliche Erfahrungen einen großen Einfluss. In der Kindheit werden die Weichen gestellt, mit wie viel Mut und Zuversicht man durchs Leben geht. Durch ungünstige Erlebnisse kann die Bereitschaft, an einer Depression zu erkranken, vergrößert werden. Häufig findet man bei depressiven Menschen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, wie geringes Selbstwertgefühl, intensives Bedürfnis nach Bestätigung durch andere sowie übermäßiges Erbringen von Leistungsnormen. In der Regel sind es dann belastende Lebensereignisse wie Todesfälle, Trennung, Scheidung oder der Verlust des Arbeitsplatzes, die eine depressive Episode auslösen.
Es können aber auch chronische Konflikte im Beruf oder im Privatleben sein oder aber langfristige Überanstrengung, beispielsweise durch die Langzeitpflege kranker Angehöriger oder wie bereits beschreiben, durch die chronische Überlastung im Beruf. Auch eigene körperliche oder psychische Erkrankungen können der Auslöser sein.
Störungen der Neurotransmitter Eine Depression lässt sich in der Regel nicht auf eine einzelne Ursache zurückführen. Es ist ein komplexes Wechselspiel, an dem auch innere Faktoren beteiligt sind. Denn hierbei ist der Stoffwechsel bestimmter Neurotransmitter im Gehirn verändert. Als gesichert gilt, dass die Konzentrationen von Serotonin und Noradrenalin im Vergleich zu gesunden Menschen niedriger sind. Auch Dopamin, Melatonin und gamma-Aminobuttersäure (GABA) sind beteiligt.
Serotonin beeinflusst fast alle Gehirnfunktionen: die Wahrnehmung, den Schlaf, die Temperaturregulation, die Sensorik, die Schmerzempfindung und -verarbeitung, den Appetit, das Sexualverhalten und die Hormonausschüttung. Kein Wunder also, dass ein Begleitsymptom der Depression Schlafstörungen sind. Durch einen reduzierten Serotoninmetabolismus wird auch die biologische Bewältigung der Stressempfindungen Angst und Aggression beeinträchtigt. Offenbar werden die Verarbeitungsmöglichkeiten für emotionale Stressreaktionen herabgesetzt. Dies führt über eine stressbedingte erhöhte Erschöpfbarkeit zur Entwicklung einer depressiven Stimmung.
Vom Botenstoff Noradrenalin wird angenommen, dass er im Gehirn maßgeblich den Schlaf- Wach-Rhythmus, die Aufmerksamkeit sowie Gedächtnis- und Konzentrationsleistungen steuert. Eine zu niedrige Konzentration kann für die Konzentrationsschwierigkeiten und die körperlichen Symptome verantwortlich sein. Die Dysbalance beider Botenstoffe kann die Wahrnehmung körperlicher Beschwerden, beispielsweise Schmerzen, verstärken.
Tabuthema Betroffene haben große Schwierigkeiten, den ersten Schritt zur Hilfesuche und Behandlung der Krankheit zu unternehmen, da sie befürchten, dass andere schlecht über sie denken und sie für schwach halten. Das Verhalten, sich keine Hilfe zu holen, scheint für Menschen mit Depressionen geradezu charakteristisch zu sein und zum Krankheitsbild zu gehören. Tatsächlich fehlt vielen Mitmenschen das Verständnis dafür, dass die Depression eine ernste Erkrankung ist, deren Symptome man nicht durch Willenskraft unterdrücken kann. Weder beim Arzt noch in der Apotheke wird also ein Patient beziehungsweise ein Kunde sein Problem konkret ansprechen. Viele wissen auch noch gar nicht, dass sie eine depressive Verstimmung oder eine Depression haben und stellen die körperlichen Begleitsymptome in den Vordergrund.
Fragen Sie bei Kunden, die zum Beispiel über Schlafstörungen klagen, daher mit viel Fingerspitzengefühl, genauer nach. Klären Sie, ob es sich um Probleme beim Ein- oder Durchschlafen oder in den Morgenstunden handelt oder ob der Kunde nachts lange wach liegt und grübelt. Fragen Sie auch, ob er sich zusätzlich auch tagsüber erschöpft und niedergeschlagen fühlt. Lassen die Antworten auf eine depressive Verstimmung schließen, ist dem Kunden mit einem Schlafmittel nicht wirklich geholfen.
Depressive Verstimmungen können im Rahmen der Selbstmedikation mit pflanzlichen Mitteln behandelt werden. Beschreibt der Kunde einen massiven depressiven Zustand mit Schwermütigkeit und Hoffnungslosigkeit, so sind die Grenzen der Selbstmedikation erreicht. Hier müssen Sie an einen Arzt verweisen.
Phytotherapie Depressive Verstimmungen, leichte und mittelschwere Depressionen sowie Angstzustände eignen sich für eine Therapie mit pflanzlichen Wirkstoffen. Nicht indiziert ist die Phytotherapie bei akuten Krisen oder schweren Depressionen. Das wohl bekannteste pflanzliche Antidepressivum ist Johanniskraut. Ähnlich den synthetischen Antidepressiva hemmt es die Wiederaufnahme der Neurotransmitter Serotonin, Adrenalin und Dopamin. Wichtig ist allerdings eine ausreichend hohe Dosierung – drei Mal täglich 300 oder ein Mal täglich 900 Milligramm werden für eine stimmungsaufhellende und ausgleichende Wirkung empfohlen.
Wie bei vielen anderen Phytopharmaka auch setzt die volle Wirkung erst nach etwa zwei Wochen ein, erste Verbesserungen können aber schon nach wenigen Tagen spürbar sein. Darauf sollten Sie Ihre Kunden hinweisen, ebenso auf mögliche Interaktionen von Johanniskraut mit anderen Arzneimitteln, wie zum Beispiel der Pille und die erhöhte Lichtempfindlichkeit. Um die innere Balance zu stabilisieren, sollte die Therapie mindestens über zwei bis drei Monate geführt werden.
SELEKTIVE SEROTONIN-REUPTAKE-INHIBITOREN (SSRI)
Am häufigsten verwendet werden aktuell Substanzen, die ausschließlich die Wiederaufnahme von Serotonin hemmen, weshalb sie als SSRI bezeichnet werden. In Deutschland sind zur Zeit Fluvoxamin, Fluoxetin, Paroxetin, Sertralin, das racemische Citalopram und sein S-Enantiomeres Escitalopram erhältlich. Anders als bei den tri- und tetrazyklischen Antidepressiva gibt es hier kaum Nebenwirkungen auf Herz- und Kreislauf. Werden SSRI zusammen mit Migränemitteln aus der Gruppe der Triptane genommen, kann es wegen der serotoninähnlichen Wirkung der Triptane zum lebensgefährlichen Serotoninsyndrom kommen. Es äußert sich durch Unruhe, Wahnvorstellungen, Herzrasen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.
Johanniskrautpräparate sind bei depressiven Verstimmungen für die Selbstmedikation zugelassen, zusätzlich gibt es verschreibungspflichtige Präparate zur Behandlung von leichten und mittelschweren depressiven Episoden, die in die Hand eines Arztes gehören. Für die Behandlung leichter Depressionen, Schlafstörungen, nervöser Unruhezustände sowie leichter Angststörungen eignet sich auch die Dreierkombination aus Johanniskraut, Passionsblume und Baldrian. Die Passionsblume hat einen Effekt auf das GABA-erge System, wirkt entspannend, beruhigend und verstärkt die antidepressive Wirkung des Johanniskrauts. Dadurch kann dieses in einer geringeren Dosierung eingesetzt werden als es in Monopräparaten möglich ist.
Baldrian beruhigt bei nervös bedingten Schlafstörungen, Unruhe und Spannungszuständen und kann so die Begleiterscheinungen einer depressiven Verstimmung mildern. Lavendel hat eine angstlösende Wirkung. Er wirkt modulierend an den Synapsen der erregenden Nerven und eignet sich besonders bei Angstzuständen und innerer Unruhe. Bei Unruhezuständen durch belastende Ereignisse oder Stress haben sich darüber hinaus auch homöopathische Arzneimittel bewährt, wie die Kombination aus Passiflora incarnata D2, Avena sativa D2, Coffea arabica D12 und Zincum valerianicum beziehungsweise isovalerianicum D4.
Synthetische Antidepressiva Bei der biologischen Hypothese der Depressionsentstehung stehen die Neurotransmitter Noradrenalin und Serotonin im Fokus. Ein Mangel führt zu einer Störung der Erregungsübertragung und ist, wie man heute weiß, an der Depression beteiligt. Es gibt zwei Wege, diesen zu beseitigen. Man kann entweder durch eine Hemmung der Wiederaufnahme oder durch Blockade der MAO die Konzentration an Serotonin beziehungsweise Noradrenalin erhöhen.
Antidepressiva werden nach ihrer chemischen Struktur in trizyklische und tetrazyklische sowie Serotonin- Wiederaufnahmehemmer, Monoaminoxidasehemmer (MAO-Hemmer) und einige weitere eingeteilt. Die ältesten antidepressiv wirksamen Substanzen sind die trizyklischen Antidepressiva. Imipramin stammt aus den 1950er-Jahren. Die Substanz wurde dann vielfach abgewandelt, es entstanden unter anderem Amitriptylin, Trimipramin, Clomipramin, Opipramol und Doxepin. Sie alle hemmen unselektiv die Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin, was sich an dem ungünstigeren Nebenwirkungsprofil zeigt.
In der Folgezeit wurden tetrazyklische Antidepressiva, wie Maprotilin und Mianserin, entwickelt. Es sind Wiederaufnahmehemmer des Noradrenalins. Bereits kurze Zeit nach der Entdeckung des Imipramins wurde der erste MAO-Hemmer gefunden, das Tranylcypromin, das die Monaminoxidase irreversibel hemmt. Es erhöht die Konzentration sämtlicher Monoamine im Gehirn, unter anderem Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, Melatonin und Histamin. Die Neurotransmitter werden nicht abgebaut, sondern bleiben längere Zeit wirksam. Tranylcypromin wird heute wegen des hohen Nebenwirkungsrisikos und der Wechselwirkungen nur noch selten eingesetzt.
Moclobemid hemmt das Enzym reversibel. Mirtazapin, ein sedierend- anxiolytisches Antidepressivum, das aus Mianserin entwickelt wurde, wirkt serotonerg und noradrenerg und außerdem auch dopaminerg. Duloxetin und Venlafaxin wirken dagegen hauptsächlich über das Noradrenalin und daher aktivierend, ähnlich wirkt Reboxetin. Bupropion wirkt wie Mirtazapin zusätzlich auf den Neurotransmitter Dopamin.
Einen anderen Mechanismus hat Agomelatin. Es ist ein Agonist an den Melatonin- und den Serotoninrezeptoren. Relativ neu ist Tianeptin. Es ist seit 2012 hier zu Lande im Handel und besitzt eine akute und eine rezidivprophylaktische Wirkung. Es verbessert auch in der depressiven Episode verminderte kognitive Funktionen. Trazodon gilt als Antidepressivum und Sedativum. Die Bedeutung von Tranquilizern, wie den Benzodiazepinen, ist in der Behandlung der Depression stark zurückgegangen. Sie dienen nur noch zur kurzfristigen Herbeiführung von Entspannung und Schlaf, um die Latenzzeit bis zur Wirkung der Antidepressiva zu überbrücken.
Da vor allem die endogenen Depressionen mehrfach im Leben auftreten können, kann in diesen Fällen zur Rezidivprophylaxe nach der Akuttherapie Lithium, Lamotrigin, Valproinsäure oder Carbamazepin verordnet werden. Lithium dient auch zur Behandlung manischer Phasen.
Den Artikel finden Sie auch in Die PTA IN DER APOTHEKE 11/14 ab Seite 34.
Sabine Bender, Apothekerin / Redaktion